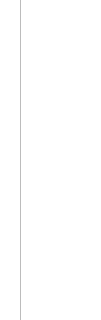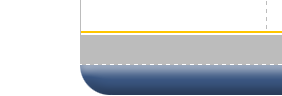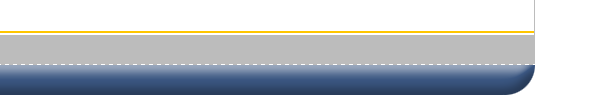Wie ich
in eine Situation eintrete, besteht mein Bewusstseinsaufkommen vielleicht zu 99
Prozent aus Unterbewusstheit, genauer gesagt, seelisch ~ physiologisch
generierter Präsenz einer bestimmten Auswahl meiner Selbstgeschichte >
selbstgeschichtlichen Wirksamkeit. Das Unterbewusste ist ja kein tumb
eigendynamisches Reservoir von archaischen, animalischen, infantil
traumatischen oder sonstwie unmündigen Impulsen und Triebausprägungen, also
‚nicht ganz auf der Höhe‘, sondern feinst gefügte, aus vormaligen bewussten
Identifikationen gebildete selbstgeschichtliche Wirksamkeit.
Wenn Freud von einer narzisstischen Kränkung des Menschen spricht,
weil dieser keine Kontrolle habe, was ihn aus dem Unterbewussten heraus
bestimmt, so ist das entscheidend zu korrigieren. Er hat es
‚kontrolliert‘ (also im Sinne von Identifikation, die ihrerseits autorisiert -
‚kontrolliert’ – wurde von der Entscheidungsinitiation) im Laufe seiner
Selbstgeschichte. Der Mensch kann lediglich die Wirkung seiner Identität nicht
im Jetzt-Moment neu konstituieren. Dann wäre sie auch nicht mehr Identität,
also Selbstgeschichtlichkeit auf der gleichen wesenhaften Höhe, wie ich mich
hier und jetzt identifiziere. Wie ich geworden bin, dass drängt vielschichtig
in die Gegenwart, und bei aller Anfälligkeit, Neurosen und Psychosen
auszubilden, sollte mich die selbstgeschichtliche Wirksamkeit doch zuerst in
freiheitliche Situationen führen. Auch die zeitgenössische
(post-)strukturalistische Theorie, dass das Unterbewusste wie eine Sprache
funktioniere, stuft es von dieser Freiheitlichkeit auf eine zuspielende
Funktionalität herunter.
Impulse, Reflexe, Triebe, Reize mögen als unterbewusst, vorbewusst
oder unbewusst definiert werden, es ist eine schier unlösbare Definitionsfrage,
ob sie dabei selbst unbewusst bleiben oder ob sie erst mit (einem Grad
von) Bewusstwerdung als Impulse und Triebe usw. zu bezeichnen seien. Es ist
hier die ganze Frage nach dem Sein des empirisch Aufweisbaren zu dem ~ mit dem
Sein des persönlich Erlebbaren aufgetan. Schon die Fragestellung ist aber kaum
zu leisten, ohne mit verfälschend identifizierten ‚Realitätsposten’ zu
verfahren.
Die Psychotherapie setzt beim Erleben an, hat hierbei aber auch mit –
so und so weit empirisch erfassbaren - Regelhaftigkeiten zu tun, mit leichter
fasslichen Zwängen wie mit komplizierteren seelischen Gestalten, die dazu noch
interaktiv sich gestalten im Therapieprozess. Erleben zu besprechen ist von
vorneherein eine recht unabsehbare Angelegenheit, mit beiderseitigen
unterschwelligen Eitelkeiten und identitätshaften Übertragungen. Das
therapeutische Gespräch mag dann als gelungen oder weniger gelungen empfunden
werden ‑ die Nachwirkungen erweisen erst richtig, was stattgefunden
hat, und zwar nicht nur auf den offenkundigen Problemfeldern, sondern
insgesamt. Es kann ein Problem gelöst sein, aber gerade mit der Problemlösung
ein viel größeres eröffnet sein. Aus einem grobschlächtig monolithischen
Verständnis heraus (Realitätsposten wie Das Unbewusste etc.) hat
vielleicht ein massiver Eingriff in filigrane Verwobenheiten stattgefunden. Das
kann schon der Fall sein, indem Dinge überhaupt angesprochen, also begrifflich
positiviert werden. Der andere mochte diese Dinge irgendwie nicht in
sprachliche Abgreifbarkeit überführt wissen, vielleicht aus einer tiefen Sensibilität
heraus, dass sie mit der Offenlegung ihre Authentizität, ihren Reiz verlieren
müssen. Viele Psychologen gehen leider wie Trampeltiere mit solchen
Verwahrungen um, versuchen gar, ein prinzipiell offenes – in realer Wirkung
offensiv konzeptionelles - Gegenüber zum Wortgebrauch herzustellen. Da gibt es
dann keinen Respekt mehr vor einer herangebildeten Stufung der Bewusstmachungen
und Benennungen, auch keinen vor ‚versunkenen Worten’. Es gibt nur noch die
schnöde Unterscheidung: worthaft belegt oder nicht. Und weil man über das
methodische Skalpell verfügt, Schlüsselworte für Fehlleistungen ans Licht zu
holen, sie zugänglich zu machen für eine offene Bearbeitung des Problems, so
tut man es auch.
Die Fehlleistung mag auf diese Weise korrigierbar sein, aber es ist
auch ein unabsehbarer Eingriff ins komplexe Ganze erfolgt. Wenn identifikativ
verinnerlichte Begriffe aus dem Unterbewusstsein herausgedockt werden, sind
damit - um in plastischer Anschaulichkeit zu reden - nicht einfach blinde
Puzzlestücke nutzbar gemacht worden, sondern ein vielschichtig hierarchisch
verwobenes Ganzes wird darauf reagieren, dass es wie ein einschichtiges Puzzle
behandelt wurde. Auf welche Weise instrumentalisierte Begriffe ihre Funktion
verändern, lässt sich pauschal natürlich nicht sagen, die Wirkung ist
jedenfalls umso problematischer, je mehr der Analysand zu einem offensiven
Umgang mit diesen Begriffen angehalten wird. Sie waren bisher vielleicht
Etappenbegriffe auf bewusste Identifikationen hin, jetzt werden sie Endbegriffe,
mit denen ich selbstbestimmend umgehe. Sie waren bisher erzählerisch
zuspielenden Charakters und gehörten so verschiedenen Identifikationsvorlagen
an, jetzt eröffnen sie handlungsworthaft dominant neue Selbstseinsweisen.
Solche aus ihren identifikativen Zusammenhängen herausisolierten Begriffe
können als Fremdkörper meine selbstgeschichtliche Wirklichkeitsverfügung
tatsächlich aushebeln. Sie wieder lebenstüchtig zu integrieren – ich muss von
meiner Selbstgeschichte her und in lebensdramaturgischer Sprache in das Jetzt
gehen – wäre oft eine hohe Kunst. Selbstgeschichtlichkeit heißt zwar auch
Veränderbarkeit, und dazu muss es die identifikative Veränderbarkeit von
Begriffen geben; wir sind ja stets dazu aufgefordert, unsere verinnerlichten,
für die bewusste Identifikation zum Tragen kommenden Weltverfügungen zu prüfen,
aber nicht lebenswissenschaftlich konkret, sondern lebensdramaturgisch sich
konkretisierend.
Ähnlich gelagert ist die Problematik von Lerntechniken. Da wird etwa
auf Phänomene wie dem Aha-Erlebnis aufgesetzt – und zuwenig realisiert, welch
unabsehbaren Eingriff solches ‚biografisch integrierende‘ Lernen in mein
selbstgeschichtlich verankertes Begreifen und Wollen darstellt. Zunächst gilt
zwar für jede Art von Lernen: Wenn ich einer Thematik folgen muss, also einer
Linie von Begriffen, die jeweils mit einer Ichcharakteristik – sowohl vom Autor
her als auch dann von mir – befrachtet sind, stehe ich in
Identitätsauseinandersetzung. Aber diese einer Raffinesse der Motivation auf
ganzheitliche Persönlichkeitsentfaltung hin (oder was jemand darunter versteht)
unterzuordnen, überführt sie in eine Art Lebensmeisterschafts-Ichbetreibung.
Die entscheidende Frage, wozu Lernerfolg gut sein soll, wird von solchen
Lernkonzepten zwar thematisiert, doch nicht in eigentlicher Tiefe aufgegriffen,
ja in Konsequenz abgefedert von einer prinzipiellen Zuversicht ins
Gebildet-Sein. Oft ist gar die Rede von einer Gebrauchsanweisung für unser
Gehirn, es wird unbedarft instrumentalisiert, auf dass wir in der Gesellschaft
– die auch zunehmend nur noch als Chancengesellschaft definiert wird – bestehen
können. Die Frage nach dem Sinn jedwelcher Bildung stellt sich aber viel
grundlegender und radikaler.
Johann Stahuber, Stand 13.5.09